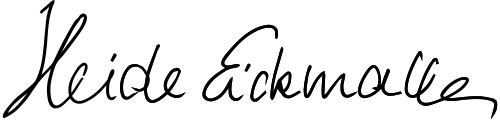„Essays über die ewigen großen Themen zu schreiben – die Freundschaft, die Familie, den Tod oder die Liebe –, ist so naheliegend wie verflixt schwer. Und es verlangt einigen Mut. Mindestens. Es haben sich ja schom zwei oder drei Leute daran versucht in den vergangenen zwei oder drei Jahrtausenden. Über die großen Themen aber auch noch entlang von Erlebnissen aus seinem eigenen kleinen Leben zu schreiben, das ist – genau genommen – eine völlig verrückte Idee, auch hauchzart größenwahnsinnig.“ Jens-Christian Rabe in der Süddeutschen Zeitung vom 23/24.August 2022 in seinem Artikel über Katja Eichinger.
Bei aller Skepsis: ich versuche es trotzdem in dem nun folgenden Text.
Gold wird es nicht sein, was wir finden, wenn wir 2022 auf der polnischen Seite des Stettiner Haffs „unseren“ Bildausschnitt ausgraben werden. Wenn es diesen Bildausschnitt überhaupt noch geben wird. In Folge 1 der Serie „Schatz gesucht“ in der Süddeutschen Zeitung wurde am 8.September 2021 von dem Fund „eines der größten Schätze der dänischen Geschichte“ berichtet. Es handelte sich um den zufälligen Fund eines Dänen, der einen Metalldetektor geschenkt bekommen und sich damit zum Spaß auf unbestimmte Suche begeben hatte. Ohne Ziel, einfach so. Der Bericht endete mit folgenden Worten: „Er (der Sucher, H.E.) findet, man dürfe die letzte Person nicht vergessen, die diesen Schatz in der Hand hielt vor 1600 Jahren. `Sie war wohl unglücklich (wird der Finder zitiert, H.E.), voller Angst vor dem Tod durch anrückende Stämme oder aber dem unnatürlichen Winter`, sagt er. Der Fund, meint er, verdiene deshalb nicht nur unsere Neugier. ´Er verlangt unseren Respekt`.`“
Doch lassen Sie mich jetzt das Bildvergrabungsprojekt beschreiben.
2017 fragt Matthias Oppermann, Bildender Künstler und Psychoanalytiker in Hamburg, seine „Kunstfreunde“ (wie er all diejenigen nennt, denen er regelmäßig via Emails von seinen Projekten erzählt und Fotos seiner Bilder schickt), ob sie sich an einer Vergrabungsaktion beteiligen wollen. Einige seiner Bilder würden in mehrere Teile zerschnitten und an Interessenten und Interessentinnen verschickt. Die Empfänger*innen müssten sich bereit erklären, die Bildteile auf eine Reise mitzunehmen und zu vergraben. Natürlich äußere ich sofort mein Interesse, und wir erhalten einen Bildausschnitt. Dieser Ausschnitt ist Teil eines Bildes, dessen Teile rund um die Ostsee vergraben werden sollen. Da wir im Herbst 2018 wie schon einige Jahre zuvor nach Usedom reisen wollen, also nah an der polnischen Grenze sein werden und wir sowieso vorhaben, einen Tagesausflug nach Polen zu machen, bieten wir unsere Teilnahme an. Als Reiseausrüstung nehmen wir 2018 neben dem Üblichen einen von dem Künstler sorgsam verpackten Bildausschnitt, einen Spaten und, für alle Fälle, eine Kinderhacke (eine andere Hacke besitzen wir nicht) mit. Das Handy für Fotos ist sowieso dabei.
„Das soll Kunst sein?“, fragt eine Freundin, als ich von dem Projekt und unseren Reiseplänen erzähle. Damals kann ich meiner Freundin keine Antwort auf die Frage geben. Ich weiß oder ahne nur, dass das Vorhaben der Bildvergrabung unserer Reise etwas Ungewohntes, ja etwas Fremdes hinzufügt. Vielleicht sogar was Abenteuerliches? Ich freue mich darauf, obwohl ich keine Ahnung habe, warum. Bisher hatten wir Polen durch Spaziergänge am Strand entlang nach Swinoujscie oder mit der Autofähre über Swinoujscie nach Miedzyzdroje und zum Wolinski Park erkundet und sind am Strand auf der polnischen Seite entlanggewandert. Steine- und Muschelsammeln und Ausblicke übers Meer auf Sonnenuntergänge hatten uns Alltagssorgen vergessen lassen. Sorglosigkeit kann ja ein wunderbarer Begleiter von Urlauben sein. Von der Grenze, die wir dann schließlich zwischen Deutschland und Polen überqueren, sind mir bis heute die Sprünge eines Jungen in eindrücklicher Erinnerung geblieben, der seiner Mutter zuruft: “Guck Mama, ich springe! Jetzt bin ich in Polen. Und jetzt bin ich in Deutschland. Siehst du, es ist ganz einfach!“ Die Leichtigkeit, mit der die Grenze von dem Jungen überwunden wird, lässt uns sowohl damals als auch heute, wenn ich daran denke, schmunzeln. Erst weiter im Landesinneren weisen breite Wald-Schneißen darauf hin, dass es vor Jahrzehnten einmal eine strenge Bewachung der Staatengrenze zwischen Polen und der DDR gegeben hatte.
Unser Bildausschnitt hat mit alledem nichts zu tun. Vom Gesamtbild haben wir nur eine rudimentäre Ahnung. Später, schon 2020, sehen wir es in Kleinformat im Katalog BILDVERGRABUNGEN I unter dem Titel ´Wartende` abgebildet. Gezeichnete Menschenköpfe vor einem grau-beige-braunen Hintergrund. Sie schauen in die gleiche Richtung. Die Figuren scheinen zu stehen, aber irgendetwas verleiht ihnen zugleich eine Art Bewegung. Ihre angedeutete Kleidung wie zum Beispiel ihre Hüte lassen sie altmodisch wirken. Wie aus einer anderen (aber welcher?) Zeit. Dies Bild wurde in sechs Teile zerschnitten, ist ursprünglich 60×90 cm groß, und die jeweiligen Teile wurden in Deutschland, Finnland, Lettland, Polen und Schweden vergraben. Die Ausgrabungen sind für 2022 vorgesehen. So lautet die Absicht des Künstlers. 2023 ist dann eine Ausstellung geplant. Weitere Informationen oder Absichtserklärungen gibt es für uns nicht.
Der Gedanke, diese Reise mit einem Tagebuch zu begleiten, kommt mir bei der Anreise nach Usedom im Herbst 2018, als wir gerade an Bernau vorbeifahren. Bernau war in meiner Kindheit – damals noch Berlin-Bernau – der Ort, von dem aus mir meine Großmutter mütterlicherseits Briefe und Postkarten schrieb. Zwischen Berlin-Bernau und Kassel, dem Ort meiner Kindheit und Jugend, lag die Grenze zwischen der „Ostzone“ (und später der DDR) und „Westzone“ (später der Bundesrepublik Deutschland). Meine Großmutter, in einem Zweibettzimmer im Altenheim wohnend, stellte mir Fragen zur Familie, zu meinen zahlreichen Geschwistern, denn, so beklagte sie, unsere Mutter ginge immer so über alles hinweg. Sie selbst berichtete von ihren nicht sehr abwechslungsreichen Tagen. Oft endeten ihre Berichte mit dem Hinweis: „Essen und Trinken schmeckt.“ Das sollte wohl heißen, dass es ihr gut ging. Von körperlichen Befindlichkeiten – und schon gar nicht von seelischen – erfuhr das Kind nichts. Was soll man dazu auch einem kleinen Mädchen schreiben, das nichts von einer Grenze weiß, nichts von Entfernung und Entfremdung, das allenfalls spürt, dass es nicht nur der andere Wohnort ist, der die Familie trennt.
Während wir 2018 an Bernau vorbeifahren, habe ich all die Bilder an die einzige Begegnung mit meiner Oma deutlich vor Augen. Ich meine, mich an ihre weiche Haut ihres Gesichts zu erinnern. Ich sehe die schütteren zum Knoten gebundenen grauen Haare, die schwarze, ärmlich wirkende Kleidung, den leicht gekrümmten, zarten Körper und ihre Augen. Ängstlich, erschöpft, unsicher. Etwas zieht in mir beim Vorbeifahren. Zahlreiche Fragen stürmen auf mich ein. Warum wurde immer nur bruchstückhaft von Mutters Vergangenheit in Berlin erzählt? Was musste oder sollte verschwiegen werden? Wie wurde gewohnt? Nur andeutungsweise erfahre ich als kleines Mädchen – schon damals neugierig – von den Folgen des Ersten Weltkrieges, den Verlust der Arbeit des Großvaters, dessen Offiziersrang vielleicht ein wenig geschönt war. Vom Alltagsleben wird nichts erzählt, Sehnsüchte und Hoffnungen, vielleicht auch Ängste blieben unter Verschluss. Im Gegenteil. Deren Offenlegung musste vermieden werden. Denn allenfalls Andeutungen zeigten in eine andere Richtung, in die man besser nicht sah; denn sie wiesen auf Armut, Versehrtheit, Scheitern und auf soziale und psychische Verwerfungen. Dafür schien es damals schon eine Mauer gegeben zu haben, allerdings nicht die spätere zwischen Ost und West, sondern viele ganz persönliche Mauern. Die Mauern des Nicht-Erzählens.
Beim Tagebuchschreiben kommen die Gedanken in Bewegung und ich frage mich, ob es soziale Scham gewesen ist, die empfunden wurde, wenn Erinnerungen drohten sich zu öffnen. Soziale Scham ist ein seelisches Gift; es schmerzt, wird unterdrückt und als Bedrohung des seelischen Gleichgewichts empfunden. So werden Bilder des realen Wohlstandes über die Erinnerungsbilder der Vergangenheit gelegt, und ich als kleines Mädchen spüre die Erleichterung, als ich mit meiner Mutter in den westlichen Teil Berlins zurückkehre. Zum Kudamm und dem pulsierendem Leben. An Abschiedsschmerz oder Tränen kann ich mich nicht erinnern.
Jetzt aber fahren wir an Bernau vorbei, erst einmal in Richtung Usedom. Um die Vergrabung „hinter uns zu bringen“, ändern wir den Routenplan und nähern uns der polnischen Grenze. Irgendwo am Stettiner Haff hoffen wir eine Stelle zu finden, an der wir graben werden. Polnische Polizisten winken uns von der Autobahn herunter. Was kommt jetzt? Ich fürchte eine Kontrolle unseres Gepäcks. Was werden wir zu dem Spaten und der Kinderhacke sagen? Dass wir am Strand Burgen bauen wollen? Wir, das alte Ehepaar? Was werden sie denken, wenn wir von dem Bildteil erzählen, das wir vergraben wollen? Warum in Polen? Werden sie uns einen Papierkorb hinhalten? Unsere Reiselust und Reisefreude bekommt einen merklichen Dämpfer. Unruhe macht sich breit. Am Rand des Grenzhäuschens stehen Menschen um einen Flix-Bus herum. Sie werden offenbar kontrolliert. Wir dann aber doch nicht. Mit freundlicher Miene werden wir wieder Richtung Autobahn gelenkt. Erleichterung macht sich breit. Bis zum kurz darauffolgenden Stau, dessen Hinweisschilder wir natürlich nicht verstehen. Wir kommen uns ein wenig verloren vor und sind immerhin beglückt, einen deutschen Radiosender empfangen zu können. Thema: Sprachverrohung. Durs Grünbein verweist im Interview auf Tagebuchaufzeichnungen von Victor Klemperer, in denen dieser offenlegt, dass der Sprachverrohung eine Verrohung des Handelns folgt. Es geht um Folgen der Flüchtlingskrise, um die politische Entwicklung in Deutschland – und in Europa. Wir denken, dass uns die Erfahrung an der Grenze eine Richtung aufzeigt, die uns Unbehagen bereitet.
Laut Karte befinden wir uns ganz in der Nähe des Haffs. Wir verlassen bei der nächsten Möglichkeit die Autobahn (ich als Beifahrerin immer mit dem Auto-Atlas auf dem Schoß) und nähern uns dem Haff über kleine Straßen durch Wald und an Feldern vorbei, auch durch winzige Ortschaften. Als wir das Haff erreichen, packen wir aus und zählen unsere Schritte am Haff entlang. Ich führe Buch, damit wir die Stelle wiederfinden, wenn wir es in drei Jahren wieder ausgraben wollen. „Unser“ Bildteil verschwindet unter einem weit verzweigten Busch, zusammen mit einer Scherbe. Diese Scherbe hatten wir Jahre zuvor auf einer unserer Tagestouren auf der polnischen Seite von Usedom gefunden, auf einem völlig zerstörten Friedhof, den wir erst durch näheres Erforschen entdeckt hatten. Auf der Scherbe waren deutsche Wortteile zu erkennen. Offenbar war es ein deutscher Friedhof gewesen, wie es solche vor dem Zweiten Weltkrieg in dieser Gegend mehrere gegeben hatte. Zu diesem Friedhof schien über viele Jahre niemand mehr gekommen zu sein. Erinnerte sich noch irgendjemand an diejenigen, die hier begraben lagen? Ein Gedanke – ganz nebenbei – gibt es noch ein Grab oder Gräber von den Angehörigen mütterlicherseits in Bernau?
Das Wetter ist trüb und der Blick über das Haff alles andere als schön, denn wir sehen nur ein paar Meter weit und als wir dann die Oder mit der Fähre überqueren, stellt sich Erleichterung ein. Einige Tage später – die Sonne scheint, Urlaubsstimmung hat sich breit gemacht – brechen wir zu einen Ausflug auf, ans Haff auf der deutschen Seite. Wir erleben einen wunderbaren Ausblick auf das sonnenbeschienene Wasser, umgeben von einem Schilfgürtel. Wir schauen auf die andere, die polnische Seite des Haffs und stellen uns vor, dass dort die Vergrabungsstelle liegt. Alles um uns herum ist ruhig und friedlich. Dass es hier, vor dreiundsiebzig Jahren, eine Flüchtlingswelle mit vielen Toten gegeben hatte, nachdem der verheerende Zweite Weltkrieg vorbei war, hatte keinerlei sichtbare Spuren hinterlassen. Eine Ausstellung im Jahr zuvor in einer kleinen Kirche in Garz mit alten Postkartenansichten von Swinemünde, Tagebuchaufzeichnungen von Zeitzeugen und die endlos erscheinenden Namensnennungen von den zahlreichen meist männlichen Toten des Dorfes hatten uns die Schrecken dieser Zeit nahegebracht. Durch dieses winzige Dorf waren Flüchtlingsströme gezogen. Bilder – vergangene und gegenwärtige – vermischten sich.
Bei Tagesausflügen am Strand entlang blicken wir auf das Meer. Die Weite, das stille Rauschen der sanften Wellen, die nahen Buchenwälder lassen Gedanken an Krieg und Flucht vergessen. Von einer Bank von der Steilküste aus entdecken wir einen Jungen, der versonnen mit seiner kleinen Schippe Sand aus dem Wasser schippt – um es auf seiner anderen Seite wieder ins Meer zu kippen. Michael sagt: „Das ist Matthias als kleiner Junge. Er vergräbt die Ostsee.“ Wir lachen.
Dann gruselt es mich doch. Was, wenn von dem Bildteil nichts übrig bleibt, Regen und Überschwemmung es vernichten? Nehmen wir an einer Zerstörungsaktion teil, einfach mal so, an einem Akt der Vernichtung? In diesem Moment möchte ich dem Künstler Spaten und Schippe vor die Füße werfen. Erinnerungen an eine reale Selbstzerstörung einer Person mit gleichem Vornamen lassen das Gefühl von etwas Abenteuerlichen durch unsere Teilnahme an diesem Kunstprojekt nicht zu. Ich fühle Wut in mir aufsteigen. Was bleibt ist der Gedanke, dass mit Vergraben die Erinnerung nicht verschwindet. Sie nimmt allenfalls zusätzliche Formen an, an die vorher nicht gedacht worden ist. Es findet eine Veränderung statt. Nicht nur der Bildteil wird sich verändern. Wir verändern uns – gewollt oder ungewollt. Eine Möglichkeit, dem Gefühl des Ausgeliefert–Seins und damit auch der ungewollten Veränderung etwas entgegenzusetzen, liegt für mich im Schreiben. Schreiben ist ein kreativer Akt, der aber in sich die Gefahr des Scheiterns birgt. Es ist eine Auseinandersetzung, die Graham Swift in seinem Buch “Einen Elefanten basteln. Vom Leben und Schreiben“ (München 2019) wie ich finde treffend benennt: „Schreiben ist auch etwas, was mich ständig mit mir selbst konfrontiert und mit dem überrascht, was ich in mir entdecke.“ Ist das beim Malen für Matthias Oppermann auch so? Ich weiß es nicht.
„Unser“ Bildteil ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Und Vergänglichkeit ist ein Thema, das unser Leben zunehmend begleitet. Enge Vertraute aus Familie und aus dem Freundeskreis erkranken schwer. Einige sterben. „Baustellen“ bei uns selber machen uns deutlich, dass es „For ever young“ nicht geben wird, so sehr wir uns auch um unsere körperliche Gesundheit und das seelische Wohlbefinden bemühen. Dazu gehört, dass uns der Urlaub im Jahr nach der Vergrabung, also 2019, wieder nach Usedom führen wird. Wir planen, mehr in das Land Polen hinein zu „schnuppern“ und fahren die Stadt Stargard an. Auf der Reise dorthin machten wir Halt bei einem Freund, dessen Frau einen Tag zuvor mit 59 Jahren verstorben ist. Sie liegt aufgebahrt zu Hause. Wir fühlen uns mit einem kompletten Stillstand von Zeit und Bewegung in uns selber und um uns herum konfrontiert. Die gefühlte Einsamkeit schmerzt. Die Fortsetzung der Reise ist durch dieses Ereignis beschwert. In Stargard wird es nicht leichter. Die Stadt, eine alte Hanse mit teilweise sehenswerten Bauten, gefällt uns nicht wirklich. Plattenbauten wurden direkt an die große und eindrucksvolle Stadtkirche herangebaut. Die Farbe Grau scheint alles zu beherrschen. Die Menschen sind freundlich. Wir brauchen lange, bis wir ein Zimmer finden, denn es scheint, dass an diesem Tag überall Hochzeiten gefeiert werden. Später spricht uns eine Frauan. Sie ist Deutsche. Sie fragt uns – die Fremden – nach einem Restaurant. Offenbar waren wir gut als Deutsche zu erkennen. Interessant ist, was sie dann unaufgefordert erzählt. Sie sei in dieser Stadt, um nach Spuren früherer Verwandter zu suchen, die hier irgendwo beerdigt sein müssten. Vielleicht könne sie was finden, was auf deren früheres Leben verweist. Neugier, Hoffnung, Trauer und eine Ahnung von Vergeblichkeit schwingen in der Stimme der Frau mit. Das Wort Vergrabung gewinnt an Größe und Bedeutung. Wir beschließen, am nächsten Tag zu der nicht zu weit entfernten Vergrabungsstelle zu fahren. Wir sind übrigens in diesem Jahr viel leichter nach Polen hineingekommen, weil wir die Autobahn früher verlassen und einen Weg durch die Dörfer genommen hatten.
Erst einmal scheint es, dass wir die Vergrabungsstelle nicht finden werden. Denn die Wegstrecke ist eine riesige Baustelle. Den Wald vom vorigen Jahr gibt es kaum noch. Er wurde für die zukünftige Autobahn gerodet und das Land wirkt wie eine wie eine Mondlandschaft. Wo sollen wir abbiegen, wenn es keine Hinweise mehr gibt, wenn wir nur geradeaus fahren dürfen, rechts und links von riesigen Baggern flankiert? Irgendwann schaffen wir es doch und bald schon finden wir auch die gesuchte Stelle. Alles ist in Ordnung. Nichts weist auf eine Veränderung hin. Bildteil und Scherbe scheinen friedlich abzuwarten, bis wir wiederkommen. Wir sind zufrieden und merken nicht, dass der Himmel über uns schwarz geworden ist. Ein Regenschauer ergießt sich über uns. Wir müssen die Kleidung wechseln. Auf dem Rückweg erkunden wir kleine Dörfer und andere Stellen des polnischen Haffs. Es ist, wenn die Sonne scheint, wunderschön dort.
Nach unserer Herbstreise neigt sich das Jahr 2019 dem Ende zu. Im neuen Jahreskalender 2020 reihen sich schon Termine an Termine: Arbeitszeiten von Michael, unsere gemeinsamen Chorproben, Familienbesuche, Stunden als Lesementorin, Ausflüge mit Freunden. Arztbesuche nehmen zu, der Gang in manche Abteilung der nahegelegenen Universitätsklinik wird vertrauter. Aber noch kommen wir dort auch wieder heraus, bis plötzlich alles anders wird. Die Sätze in den Nachrichten, wie „Von einer Pandemie kann man zurzeit nicht reden“ verändern sich, werden konkreter: „Es handelt sich, Stand heute, um eine Pandemie!“ Was ist das? Mit dem Kopf verstehen wir es. Aber mit dem Herzen? Intensivbetten und Särge bestimmen die Bilder in den Nachrichten. Ausgangsbeschränkungen, Abstandsregeln und Maskenpflicht sickern in den täglichen Sprachgebrauch. Die Alten über 70 sind besonders gefährdet. Über 70? Wir? Unsere Tochter bringt uns Einkäufe – und bleibt zwei Meter vor uns stehen. Keine schnelle Umarmung, kaum ein Lachen, dafür umso häufiger besorgte Mienen. Am nahe gelegenen Briefkasten hängt ein Zettel in Kinderschrift mit Telefonnummer: „Ich kann Ihnen bei ihren Einkäufen helfen.“ Städte wie Bergamo erleben Traumatisches. Wir schauen über die Nachrichten zu. Es wird für Mitarbeiter*innen in Kliniken geklatscht. Rasch besinnen wir uns auf unsere privilegierten Möglichkeiten, unseren mehr als ausreichenden Platz zu Hause, das Interesse an Büchern und Filmen, Videoschalten, YouTube-Vignetten mit wunderschöner Musik, die uns zu Tränen rühren, lustige Clips zur aktuellen Lage. Ein bisschen Französisch lerne ich auch. Aber lustig ist eigentlich gar nichts. Wir reden zwar, aber trotzdem würde ich es ein inneres Verstummen nennen, was vor und mit uns geschieht. Herr Altmayer verspricht, Frau Merkel warnt und wir gewöhnen uns an bisher unbekannte Namen wie Wieler, Drosten, Streek, Brinkmann und andere. Solidarität? Die findet im Netz statt – wenn überhaupt. Singen? Ist lebensgefährlich. Öffnung für Gemeinsamkeiten? Alles schließt. Immerhin wandern wir. Unsere Umgebung ist wunderbar. Der Himmel ist blau. Es ist ruhig. Kein Flugzeug. Die Ereignisse als ein Science-Fiction-Film? Hätte ich mir nie angeschaut. Jetzt erlebe ich es. Bis zum Frühjahr und weit in den Sommer hinein, als sich alles zu beruhigen und zu glätten scheint. Wir treffen uns mit Freunden in den Gärten und sind vorsichtig und besonnen. Und schaffen es – alle Familienmitglieder und Freunde und Freundinnen – wohlbehalten bis ins Jahr 2021. Dann gibt es Impfstoff. Eine große Erleichterung stellt sich wieder ein. Mit Vorsicht. Einigen Zweifeln. Auch Ängsten. Und viel Hoffnung.
Matthias Oppermann scheint unruhig geworden zu sein. Im August 2021 erreicht uns die Nachricht, dass er drei Bildteile ausgegraben hat. Er käme, so seine Begründung, 2022 nicht wie geplant nach Dänemark, deshalb habe er sich dort schon jetzt für die Ausgrabung entschieden. Ich argwöhne andere Gründe: besagte Unruhe, Zweifel, was aus dem Projekt wird, wenn ein Reisen schwer oder sogar unmöglich bleiben wird, denn mehrere Freunde von uns müssen auf das Reisen zu ihren Kindern verzichten, können ihre geborenen Enkel nicht sehen, können auch selber nicht besucht werden. Werden wir 2022 nach Polen reisen und „unser“ Bild ausgraben können? Die Nachrichtenlage verschlechtert sich im Herbst zusehends. Nicht nur, was die Pandemieentwicklung angeht – es geht wieder um belegte Intensivbetten, und um Impfverweigerer, Querdenker. Querdenken ist doch eigentlich ein schönes Wort. Nicht nur immer geradeaus denken. Widersprüche benennen. Politik und Maßnahmen überdenken. Aber gegenwärtig wird Querdenken für mich zum Schimpfwort, weil ich mich frage, was noch passieren muss, damit sich die Lage verbessert und sich mehr Menschen impfen lassen. Und dann die Nachrichten von der polnisch-belarussischen Grenze. Wieder schauen wir auf Elend und den Platz in der Hölle, die nicht erst nach dem Tod wartet sondern täglich vor unseren Augen zu sehen ist.
Schaue ich erst einmal beim jetzigen – vorläufigen – Ende meiner Ausführungen auf das, was der Künstler beschreibt, wie er die ausgegrabenen Bildteile vorgefunden hat. Ich zitiere im Folgenden aus seinem Bericht zu den drei vorgefundenen Bildteilen und ihrem Zustand. Zum Bildteil 1: „Das Bild lag unter einen dünnen Erdschicht, beschwert mit Steinen. Material Leinen. Das Bild blieb in der Struktur unversehrt. An einigen Teilen hatte sich die Farbe gelöst und die Grundierung wurde sichtbar. Wurzeln und Leinenfäden hatten sich an einer Stelle verbunden. Die Oberfläche sah aus wie eine Haut.“ Zum Bildteil 2: „Bild Nr. 7 und Nr. 10 wurden nebeneinander vergraben. Sie lagen wenige Zentimeter unter der Erde und wurden beim Vergraben mit Schieferplatten bedeckt. Die Platten waren total zerbröselt. Material Leinen. Pflanzen, Gräser waren durch das Bild gewachsen. Um es zu bergen, musste ich es von den Wurzeln trennen. Die Farbschicht war teilweise abgesplittert. War bei Nr. 3 das Motiv teilweise noch zu erkennen, war hier ein neues Bild entstanden.“ Bildteil 3: „Das Bild Nr. 10 ließ sich nur in Einzelteilen bergen. Die Leinwand war teilweise zerstört. Material Baumwolle. Es war nur schwer möglich, das Bild in seiner Struktur zu rekonstruieren. Es entstand bei der Rekonstruktion ein neues Bild. Die Leinwand scheint pflanzliche Beschaffenheit angenommen zu haben.“
Alle Bildteile waren verändert. Einmal sei, so führt er aus, sogar ein neues Bild entstanden. Stimmt das hoffnungsvoll? Werden wir 2022 unser Bildteil wiedetrfinden, gar etwas Neues entdecken, neben der Scherbe aus dem alten Grab unweit der polnischen Grenze? Beim Schreiben kommt mir der Gedanke, ob die Scherbe sozusagen das Bildteil „bewacht“ haben könnte. Ein merkwürdiger Gedanke.
Hier enden meine – bisherigen – Tagebuchaufzeichnungen. Ich hoffe auf eine Fortsetzung.
Dezember 2021