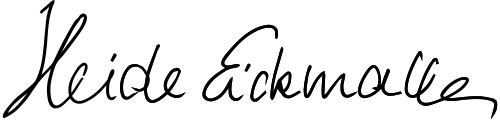Laudatio für Dow Aviv anlässlich der Verleihung der Hedwig-Burgheim-Medaille an ihn durch die Stadt Giessen am 28.8.2024
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Dow Aviv, verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
man möge mir verzeihen, dass ich im Folgenden nicht von Dow Aviv spreche, denn das klingt aus meinem Mund irgendwie falsch. Ich kenne dich als Dubi, und das schon ziemlich lang. 1998 zum Beispiel – und das war nicht das erste Jahr unserer Begegnung – schenktest du mir ein Buch zum Geburtstag. “Judiths Liebe“ von Meir Shalev, einem bedeutenden israelischen Schriftsteller.
In dem Buch herrscht einiges Durcheinander nicht nur in den Familien in dem Dorf, in dem Judith mit ihrem Sohn lebt und dessen Vater unbekannt ist, und so hatte ich ein wenig Mühe, mit dieser mir fremden Welt vertraut zu werden.
Als ich das Buch jetzt, in Vorbereitung auf den heutigen Tag, erneut zur Hand nahm, habe ich es sozusagen mit anderen Augen gelesen. In Judiths Dorf leben Kanarienzüchter, Rinderzüchter, Viehhändler, Hühnerzüchter, Gänsezüchter und auch Lastwagenfahrer. Und die meisten verehren Judith nahezu heißblütig. Flora und Fauna der Dorfumgebung sind reichhaltig – so wie es auch Herr Apel in seinem Buch über den Nahen Osten im Rahmen der Religiösen Woche kürzlich begeistert beschrieben hat.
Von dir heißt es, du bist in Jaffa geboren. Bist du auch dort aufgewachsen, oder ist dir das Dorfleben eher vertraut und hat dich dazu bewogen, Tiermedizin studieren zu wollen? Das war in Israel damals nicht möglich und ist einer der Gründe, warum du hier in Giessen gelandet bist. Nun, die Tiermedizin entsprach dann doch nicht deinen Interessen und du hast zur Zahnmedizin gewechselt.
Nun zurück zum Buch. Judith schläft im Kuhstall – und ihre nächtlichen Schreie schrecken jede Nacht die Dorfbewohner auf. Warum sie schreit, weiß niemand. Überhaupt belässt Shalev vieles in Andeutungen: da wird Odessa als ferne Heimat genannt, Litauen taucht auf, die Ukraine und an anderer Stelle teures russisches Geschirr, was nicht in die dörfliche und eher ärmliche Umgebung zu passen scheint. Alles weist auf verschiedene Herkunft ihrer Bewohner hin, und auf angedeutete Fluchten und Vertreibungen und auf Bewohner, die immer schon im damaligen Palästina und dann im gegründeten Israel leben. Auch hier sehe ich einen Verweis auf deine Familiengeschichte. Denn dein Großvater hatte die Familie auf der Flucht vor den Nationalsozialisten von Polen ausgehend durch weitere Länder Osteuropas bis hin nach Kasachstan geführt.
Shalev schreibt nicht düster über die verschiedenen Lebensschicksale, sondern durchaus humorvoll, auch wenn Melancholie, das Schwere hinter den einzelnen Schicksalen, deutlich zu spüren ist.
Ich habe mich gefragt, ob dieses Dorf etwas von deinem früheren Leben in Israel zeigt, von dem du mir später erzählt hast. Wenn wir uns in den vergangenen Jahren trafen, meist bei Geburtstagen und anderen Gelegenheiten, also meistens heiteren Anlässen, erzähltest du wenig von deinem früheren Leben. Du warst zwar deutlich präsent, lachtest gerne, aber ein Teil von dir blieb eher im Hintergrund. Klar war, dass du Jude bist und aus Israel stammst, viel mehr aber nicht. Über Religion sprachen wir so gut wie nie. Dass du damals schon am Aufbau der jüdischen Gemeinde mitgewirkt, sie mit gegründet hast, wusste ich nicht.
Besonders klar war aber, dass du gut kochst, was manche deiner Freunde, mit denen du ab und zu in der Küche stehst, zu dem Spruch verleitet hat: „Man kocht nicht mit Dubi, man kocht unter ihm.“ Im Buch von Shalev spielt das Kochen übrigens eine besondere Rolle. Es hilft beim Erzählen, es öffnet nicht nur die Geschmackssinne sondern auch die Bereitschaft, sich mitzuteilen, sich zuzuhören, unbeschwert zusammen zu sein.
Heute würde ich sagen, dass über lange Zeit etwas von dir verborgen geblieben ist, was nur manchmal, wie zufällig auftauchte: Vergangenheit. Wenn deutsche auf jüdische Geschichte traf, wurde es schwieriger. Irgendwie ging man darüber hinweg oder jeder blieb mit seinen Gedanken und Gefühlen allein. Wie sehr aber das Verborgene in dir arbeitete, zeigte sich in manch tiefen, verletzenden Rissen in wertvollen Beziehungen und Krisen, die den Boden unter dir heftig erschütterten.
Und es gab ja auch vieles andere, was wir manchmal eher bei der Zeitungslektüre am Frühstückstisch mitbekamen. „Ach guck mal, Dubi hat wieder mit den Rollstuhl-Basketballern Lahn-Dill ein Turnier gewonnen“, hieß es da zum Beispiel. Der Sport bildete für dich von je her ein wichtiges Element. Schon in Israel entdeckte ein Trainer bei einem Feriencamp am Meer die Begeisterung des kleinen Jungen aus der zweiten Klasse für das Schwimmen.
Ich habe mir vorzustellen versucht, wie du im Meer geschwommen bist. Mir ist nicht gelungen, dich als verbissen ehrgeizigen Schwimmer zu sehen, sondern einen Jungen, der die Leichtigkeit des Wassers genießt, sozusagen sich mit ihm eins und leicht fühlt, und auf jeden Fall anders, als es das Handicap durch die frühe Polio- Erkrankung ermöglicht hat. Aber beharrlich wirst du gewesen sein. Beharrlich hat auch Magdalena Ihre Leidenschaft für das Rudern gepflegt. Und so verbindet Euch neben vielem anderen die Leidenschaft für den Sport.
Die Beharrlichkeit, die auch heute Bestandteil deines vielfältigen Engagements ist und die dich auszeichnet. Und bis zum Schwimm-Kader für die Para Olympics 1972 geführt hat. Die Teilnahme kam dann nicht zustande. Zum Glück. Wir erinnern uns alle an die schrecklichen Geschehnisse in München 1972. Heute werden übrigens die Para-Olympics in Paris eröffnet und wir wünschen allen dort friedliche und schöne Spiele.
Und dann gab es meinerseits eine überraschende Entdeckung beim Studium der Wahlzettel – welche Wahl es war, ist mir gerade entfallen – zum Kumulieren und Panaschieren. Ich habe die Zettel auf dem Esstisch ausgebreitet, weil ich nicht erst in der Wahlkabine sehen wollte, wem und welcher Partei ich meine Stimmen gebe. Da entdecke ich Dow Aviv auf einem der hinteren Plätze und höre mich – allein zu Hause – laut sagen: „Dubi, was machst du denn da?“ Ich kann es hier offen sagen und Dubi weiß es, dass sein Name nicht in der Partei stand, die ich bevorzugt hätte wählen wollen. Aber so war und ist unser Kontakt: wir müssen nicht einer Meinung sein. Es ist selbstverständlich, dass wir die Verschiedenheit in Ansichten und unterschiedlichen Lebensführungen akzeptieren und als eher bereichernd als verstörend erleben.
Nach und nach sah ich dich dann bei Gedenkveranstaltungen, Musikabenden der jüdischen Gemeinde und anderen von der jüdischen Gemeinde initiierten Ereignissen eine mehr und mehr verantwortliche Position einnehmen. Und ich staunte. Wie gut du reden kannst! Was du dich traust! Du tratest sozusagen aus dem Verborgenen hervor. Wurdest als Vertreter der Jüdischen Gemeinde immer sichtbarer.
Für mich besonders beeindruckend war dann die Gründung der jüdisch-islamischen Gesellschaft. Das versprach einen nicht geringen Baustein in Richtung Verständigung und Frieden. Vom kleinen Giessen eine Botschaft in die Welt. Wenn das nicht Zuversicht und Hoffnung versprach! Später, wieder in Vorbereitung auf den heutigen Tag, erzählte mir Doktor Aydin, Vertreter der islamischen Gemeinden und Mitbegründer der jüdisch-islamischen Gesellschaft, wie Ihr Euch nach und nach angenähert habt. Wie leicht du es ihm gemacht hast in eurer gemeinsamen Verständigung, wie dankbar er dir dafür ist. Und besonders dankbar dafür, dass du mit ihm und Bernd Apel den Koran nach den Koranverbrennungen in überzeugtem Respekt gehalten hast, in Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift.
Ich denke, dass Ihr Beide auch etwas anderes gemeinsam habt. Hier in Giessen oder im Umland zu Hause zu sein, Familie, Freunde und Freundinnen zu haben ist das eine, eine Verbindung zu vielen. Aber dass es da etwas gibt, eine Herkunft oder einen Hintergrund, der auf etwas anderes verweist, was denen, die immer hier wohnten, die von Kindheit an die gleiche Sprache sprachen, die andere Länder nur aus der Besucherperspektive kannten, deren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern höchstens von einem Dorf in ein anderes oder von einer Stadt in eine andere Stadt innerhalb Deutschlands gezogen waren, dass diese nur in Teilen wissen, wie es sich anfühlt, manchmal – und das sogar plötzlich, wie aus heiterem Himmel – als Fremde wahrgenommen zu werden. Oder sich fremd zu fühlen. Als sei die Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft und damit die Bereicherung, die ihr beide für uns alle bedeutet, plötzlich nicht mehr selbstverständlich.
Der Schmerz hat Euch sicher auch begleitet bei der Vorbereitung und Durchführung des Friedensgebets am 21.12. vorigen Jahres, zusammen mit Vertretern und Vertreterinnen der christlichen Kirchen in Giessen. Etwas versteckt hinter dem Weihnachtmarkt habt Ihr um die Opfer und Geiseln vom 7.Oktober getrauert, habt für sie und die Opfer in Gaza gebetet und mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmern für einen guten oder erträglichen Ausgang der kriegerischen Auseinandersetzungen gehofft. Ich war zutiefst dankbar für dieses Friedensgebet. Es gab einen Ort, wo man die Erschütterung und Verzweiflung teilen konnte.
Hinter uns plauderten junge Menschen, die nichts von der kleinen Zusammenkunft mitbekamen, munter auf dem Weihnachtmarkt. Ihre Stimmung war heiter und- manche mögen das anders erlebt haben- auch das hatte etwas Tröstliches. Nämlich, dass es ein Leben in Unbeschwertheit geben kann. Und dennoch: Etwas Unvorstellbares war passiert, ein Pogrom. Ein erneuter, furchtbarer Krieg brach aus, der bis heute kein Ende findet.
Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat einfügen, in dem die Erschütterung genannt wird. Es ist von Maria Stepanova, einer russisch-jüdischen Autorin, die heute in Berlin lebt.
„Über lange Zeit basierte mein (und ich denke, nicht nur mein) Lesen, Schreiben, Denken auf der Annahme, wir lebten in einem post-katastrophischen Zeitalter und die zentrale Frage unserer Zeit sei, wie wir mit der Erinnerung an die Vergangenheit, mit der Erinnerung an die Katastrophe/n umgehen. Jetzt erkennen wir, dass es tatsächlich ein Leben im Vorfeld der Katastrophe war, die erst noch dabei ist, sich zu entfalten – und das verändert alles…“. Maria Stepanova meinte den Überfall auf die Ukraine. Sie sprach davon vor dem 7.Oktober, und wir wissen, dass es mit dem Überfall der Hamas, deren Morden und die Geiselnahme in Israel und mit dem darauf folgenden Krieg in Gaza eine weitere Katastrophe gibt, die uns täglich erschüttert.
Welche Katastrophen zu überwinden waren und wie wir beide ein Teil davon sind, ahnten wir zwar immer schon, aber wie konkret sich da etwas in den Leben unserer Vorfahren auf erschütternde Weise verwoben hatte, stellten wir fest, als ich dich kürzlich zu deiner Herkunft-Familie befragte. Du erzähltest von der Fluchtgeschichte deiner Vorfahren, ich sprach von der anfänglichen Begeisterung meines Vaters für den Nationalsozialismus. Das mag für manchen von Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, als Zumutung empfunden werden. Aber das ist unsere Geschichte. Wie können wir da zusammenkommen, uns mögen? Und wie kann es sein, dass du ausgerechnet mich gebeten hast, heute hier zu sprechen? Dass es eigentlich unmöglich sein könnte, drückt Hilde Domin in einem Gedicht aus, das ich Ihnen vortragen möchte.
Haus ohne Fenster
Der Schmerz sargt uns ein in einem Haus ohne Fenster. Die Sonne, die die Blumen öffnet, zeigt seine Kanten nur deutlicher. Es ist ein Würfel aus Schweigen in der Nacht.
Der Trost, der keine Fenster findet und keine Türen und hinein will, trägt erbittert das Reisig zusammen. Er will ein Wunder erzwingen und zündet es an, das Haus aus Schmerz.
Hedwig Burgheim ist dem Haus ohne Fenster zum Opfer gefallen, ganz entgegen ihres Engagements für Kinder, die sie im Sinne Fröbels erzogen wissen wollte. Ich zitiere: „Fröbel ging davon aus, dass jedes Kind von Natur aus neugierig und lernbereit ist. … Fröbel betonte auch, das jedes Kind einzigartig ist und seine eigenen Stärken und Förderschwerpunkte hat.“ (Zitatende).
Ein „… und dennoch“, das immer wieder von Hedwig Bugheim genannt wird, bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, die andere Meinung nicht gelten zu lassen. Im Sinne eines ablehnenden Nein. Sondern als die Eröffnung anderer, neuer Perspektiven. Noch einmal etwas überdenken, im Respekt voreinander. Die Fenster zu öffnen.
Hat dein Großvater in diesem Sinne gedacht? Ihm ist es zu verdanken, dass die Fenster nicht verschlossen geblieben sind. Er gab dir mit auf den Weg, dich niemals verbissen mit anderen, die laufen und springen können, was dir nicht möglich war, zu messen. Aber, und das hat sich bei dir eingebrannt, miteinander zu reden und zuzuhören. Das kannst du, das ist das, was dich bis zum heutigen Tag begleitet hat.
Auch bei mir gab es ein Fenster, und das waren die Gespräche mit meinem Vater, der sich dem jüngsten seiner Kinder anvertraute. Kein schweigender Vater, wie es so viele gab. Ein Vater, der von verzweifelter Reue gekennzeichnet war. Ich glaube, und für manche mag auch das wie eine Zumutung klingen, aber ohne diese Gespräche stünde ich heute nicht hier.
Ich möchte jetzt mit einer Fantasie enden. Denn, man mag mir meine kindliche Sehnsucht verzeihen, ich stelle mir vor, dass dein Großvater irgendwie unter uns ist. Die Fantasie geht so: deine Großeltern sitzen zusammen auf einer Bank. Sie reden in der Sprache miteinander, die sie immer dann benutzten, wenn du nicht verstehen solltest, worüber sie reden. Also hast du natürlich, pfiffig, wie du warst, auch ein paar Brocken Russisch gelernt. Der Dialog geht so:
„Was hat der Junge wieder angestellt?“
„Warum, was meinst du? Auf Bäume klettern kann er doch nicht mehr. Weißt du noch, wie wir früher gezittert haben, wenn er es doch gewagt hatte und bis ganz oben geklettert war? Was hatten wir Angst um den Jungen!“
„Nein. Er bekommt eine Medaille.“
„Eine Medaille? Schwimmt er denn immer noch? Ich meine auf Turnieren und so? Ist er nicht zu alt dafür?“
„Nein. Er bekommt die Medaille für sein Engagement, für unsere Religion. Für die Verständigung der Religionen untereinander. Für die Stadt.“
„Oh, da muss er aber klug sein. Und mutig. Das vor allem.“
„Er ist dein Enkel.“
„Und wie heißt die Stadt?“
„Giessen. Sie hat eine große Universität.“
„Giessen? Wo ist denn das?“
„Irgendwo in der Mitte in Deutschland. Nah bei Frankfurt/Main, meine ich.“
„Oh. Ausgerechnet. Deutschland.“
„Glaubst du, da sind sie gut zu ihm?“
„Er ist gut zu den Menschen dort. Dann werden sie gut zu ihm sein.“
„Meinst du? Wollen wir hoffen?“
„Wir hoffen und beten. Für ihn. Für unseren Dow. Und für seine Stadt. Und sein Mädele. Unsere Dattelpalme.“
So, lieber Dubi, herzlichen Glückwunsch sagen wir alle, deine Freundinnen und Freunde, die Vertreter der Stadt Giessen, alle hier Anwesenden